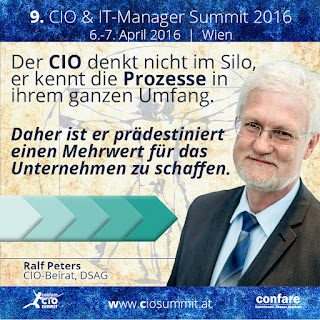Die Auswirkungen des Energieeffizienzgesetzes auf Unternehmen unterschiedlichster Größe sind schwer abzusehen. Energielieferanten haben bereits mit teilweisen Preiserhöhungen begonnen. Dienstleister bieten Audits an und IT Anbieter setzen auf den Vertrieb neuer Systeme.
Wir bieten am 25./26. Juni ein Seminar dazu an (Bundes-Energieeffzienzgesetz – Aktuelle (Compliance)verpflichtungen, Nutzen und Chancen) und ich hatte die Gelegenheit mit unseren Referenten ein Gespräch zu führen, das ein bisschen Licht in die Sache bringt: Was können Unternehmen wirklich tun? Welche Nutzen haben sie und welche Kosten? Welche Förderungen gibt es und was müssen Immobilienunternehmen beachten? Antworten dazu gibt es von Udo Altphart und Christian Ehrenhauser.
 |
| Christian Ehrenhauser |
 |
| Udo Altphart |
Wie haben Unternehmen bisher auf das Energieeffizienzgesetz reagiert?
Sehr unterschiedlich. Neben Unternehmen der energieintensiven Industrie, für welche Energiemanagement ohnehin immer schon einen wesentlichen (Kosten-)Aspekt des Kerngeschäftes darstellt und bei denen entsprechende Strukturen bereits vorliegen, sind aktuell differenzierte Herangehensweisen der betroffenen Unternehmen zu beobachten. Teils wird dieses Materiengesetz als eine „weitere“ (mit hohem Verwaltungsaufwand empfundene) Compliance-Verpflichtung für die Geschäftsführung interpretiert, teils beobachten die betroffenen Unternehmen auf Grund „empfundener (Rechts)Unsicherheit“ das Marktumfeld mit entsprechender Zurückhaltung.
Dabei trug die erneute Vergabe der Monitoringstelle und offene Fragen zur Erfüllung bzw. Umsetzung des Gesetzes nicht gerade als vertrauensbildende Maßnahme am Markt bei. Es zeigt sich, dass im Umfeld von derzeit (noch) niedrigen Primärenergiekosten sowie spezifischer wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen der Unternehmen das Thema Energieeffizienz erst dann erhöhte Priorität erfährt, wenn die Energiekosten mindestens 3 % der Gestehungskosten betragen. Positiv ist anzumerken, das Unternehmen die impliziten Themen Umweltdaten- bzw. Energie(daten)management auch im nachhaltigen Kontext aufbereiten und auf eine nachhaltige Mehrwertschaffung abzielen. Teilweise finden sich diesbezüglich auch bereits einschlägige Anforderungen im Rahmen internationaler Ausschreibungen wieder. Die Energielieferanten, wobei hier darauf hingewiesen werden sollte, dass nicht nur klassische Energieversorgungsunternehmen als „Energielieferanten“ durch das Gesetz betroffen sind, stehen vor zusätzlichen Herausforderungen. Unter anderem sind diese aufgefordert, Nachweise über Energieeffizienzmaßnahmen zu erbringen.
Die im Gesetz geforderten Ausgleichszahlungen sind bereits Bestandteil reger Diskussionen (Bestandteil Energiepreis? Weiterverrechnung an Endkunden?).
Wo besteht der dringendste Handlungsbedarf?
Energieeffizienzthemen einschließlich der Subthematik Energieaudit fallen – nicht nur aus Haftungsgründen – in die Zuständigkeit des Top Managements. Eine entsprechende Bekennung zum Thema, die Entwicklung diesbezüglicher Politiken und Strategien erfolgt bestenfalls – und vor allem von Projektbeginn an - unter Einbindung aller Fachbereiche (Technik/Recht/Finanzen & Controlling). Dies schließt sinngemäß auch ein, dass rechtzeitig ausreichende Ressourcen (interne/externe, insbesondere personelle Ressourcen) zur Verfügung gestellt werden, sodass im Sinne eines nachhaltigen Projektmanagements bestehende Qualitätssicherungs-, (Risiko)managementsystemstrukturen sowie vorhandene aber auch kurz- bis mittelfristig geplante Reportingsysteme optimal eingebunden werden.
Wesentlich ist im ersten Schritt – vor allem auch für die effiziente Durchführung eines Energieaudits – eine Bestandsaufnahme und Identifikation von Ressourcenverbräuchen. Eine entsprechende Erstanalyse hinsichtlich Umfang und Leistungsfähigkeit des beim Unternehmen bestehenden Messwesens sind sinnvollerweise vor dem Audit bzw. im Rahmen eines Pre-Audits durchzuführen. Sofern nicht vorhanden – sollte unter Berücksichtigung der zukünftigen/beabsichtigten Verwendung der (Umwelt-/Energie-)messdaten ein institutionalisiertes Energieverbrauchsmonitoring zum Einsatz kommen – entsprechende IT-Ressourcen (Hard-/Software) sind hier sinngemäß zu berücksichtigen: Je nach Umfang und Verwendung der Daten ist eine Bestandsaufnahme bestehender IT-Systeme hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Schnittstellenfähigkeit und nachhaltiger Erweiterbarkeit im Kontext Umsetzung „Energieeffizienz-Projekte“ (Simulationsfähigkeit Bandbreiten, Messwesen, revisionssichere Reporting- und Kontrollsysteme etc.) als vorrangig einzustufen.
Der Ressourceneinsatz für die Anschaffung bzw. den Betrieb von (halb-)automatisierten IT-Systemen ist dabei jedenfalls den alternativ verstärkt anfallenden Personalkosten für die (Energieverbrauchs-)Datenerhebung bzw. dem erforderlichen laufenden Monitoring der Messdaten gegenüberzustellen. Etwaige Fehlerpotentiale bei manuellen Schnittstellen bzw. Kontrollen unterstützen die Argumentation für praxiserprobte Lösungen im Messwesen bzw. Energieverbrauchsmonitoring – insbesondere bei Unternehmen mit mehreren Betriebsstandorten bzw. mit entsprechendem Filialnetz.
Wie können die Unternehmen das Energieeffizienzgesetz zu ihrem Vorteil nutzen?
Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik Energieeffizienz können “hidden treasures” identifiziert werden. Der Anlassfall “Energieaudit” sollte auch für weitreichende/bereichsübergreifende Analysen genutzt werden und kann somit auch zur Erhöhung der wirtschaftlichen Versorgungssicherheit beitragen. Eine entsprechende Vermarktung der diesbezüglichen Unternehmensaktivitäten unterstützt gegebenenfalls auch das Kerngeschäft der Unternehmen (bei Ausschreibungen existieren oftmals bereits Auflagen im Bereich Dokumentationen bzw. Berichtswesen im Nachhaltigkeitsumfeld) Auf Grund der Vielschichtigkeit des Themas können die Unternehmen auch gegebenenfalls an neuen Geschäftsfeldern/Energie(effizienz)dienstleistungen – nach Abwägung Ihres diesbezüglichen Chancen-/Risiko-Profiles bzw. Risikoappetit - partizipieren. Bei entsprechender Aufbereitung können auch finanzielle Anreize wie einschlägige Förderungen bestmöglich ausgenutzt werden.
Was sind konkrete Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihren Energiebedarf steuern können?
Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen – dabei bedarf es nicht zwingend von wesentlichen Investments, um nachhaltige Energie- und somit Kosteneinsparungen zu erzielen. Grundlegende Voraussetzung ist ein entsprechendes Energiebewusstsein im Unternehmen, wobei hier auch anzumerken ist, dass die alleinige Berücksichtigung von abrechnungsrelevanten Energieversorger-Abrechnungszählern oft nicht ausreicht - die Implementierung von zusätzlichen spezifischen Zähleinrichtungen stellt die notwendige Detailierung von Messbereichen sicher. Der Ansatz bei der optimalen Zielerreichung von Maßnahmen ist eine Priorisierung nach Wirkung und Menge. Das bedeutet, dass der Aufwand der aufgezeigten Maßnahmen in Relation zur erzielten Wirkung analysiert werden muss. Es ist nicht zielführend, entsprechende Ressourcen für Maßnahmen einzusetzen, welche repräsentativ erscheinen, aber der diesbezügliche Aufwand zum Effizienzgewinn sich nicht lohnt.
Ein typisches Beispiel dafür ist die Beleuchtung: Man visualisiert schnell diese Maßnahme, aber die Wirkung ist oft sehr enden wollend. Im Gegensatz dazu, sind z.B. Maßnahmen im Bereich Klimatechnik (Kältemaschinen) oft viel wirkungsvoller – beispielsweise durch hydraulische Maßnahmen. Ein anderes Praxisbeispiel ist ein Industrieroboter – dieser wurde im konkreten Fall bisher nicht untersucht, d. h. es wurde keine Messanalyse durchgeführt, welche Verbräuche außerhalb der Betriebszeiten im Standby-Modus anfielen. Die durchgeführte Messanalyse zeigte, dass 2/3 der Leistung des Roboters im Standbybetrieb abgerufen wurde.
Auf Grund der komplexen und unternehmens- bzw. objektspezifischen Thematik zeigt sich auch die Notwendigkeit von Energieeffizienzmaßnahmen-Datenbanken. Neben dem bestehenden (bzw. in Kürze überarbeiteten) Methodendokument der Austrian Energy Agency, werden hier sicherlich zukünftig Plattformen, wo (gegebenenfalls auch „neu identifizierte“) Maßnahmen abgebildet werden können, an Bedeutung gewinnen.
Was wird das Energieeffizienzgesetz den Unternehmen kosten – vom KMU bis zum Konzern?
Entsprechend der jeweiligen Unternehmensstrategie zu dem Thema Energieeffizienz (short-term-Erfüllung Compliance-Verpflichtung vs. nachhaltige Umsetzung durch gesamtheitliche Lösungen) sind interne und externe Ressourcen zu berücksichtigen. Seitens Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wurden unverbindliche Schätzungen für zu erwartende Kosten für die Durchführung von Energieaudits bzw. der Einführung von Energiemanagementsystemen verlautbart (jedoch erfolgte auch hier der Zusatz, dass hier nur entsprechende Schätzungen vorliegen und auf Grund der jeweils individuellen Unternehmensstruktur entsprechende Kosten zu erwarten sind). Beispielhaft sei hier angeführt, dass Bauträger oft vermuten, dass der gesamte Gebäudebestand zu auditieren ist. Jedoch alleine jenes Gebäude ist zu betrachten, in dem die Form selbst Energie verbraucht.
D. h. die vermieteten Bereiche fallen nicht unter ein Audit. Dies wiederum heißt, dass ein Audit für einen Bauträger sehr günstig gestaltet werden kann, weil allein die Büroräumlichkeiten betrachtet werden müssen. Jene Unternehmen die entsprechend dem Bundesenergieeffizienzgesetz nicht betroffen sind, also KMUs, können trotzdem die Motivation aufbringen eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Die Motivation die für KMUs liegt in der "Wertigkeit" der Energieberatung entsprechend dem derzeitig vorliegenden Methodendokument. Der Wert einer Energieberatung ist derzeit 3% des gesamten Energieverbrauchs des KMU. Diese theoretischen kWh sind bei einem Energieversorgungsunternehmen geschätzte ca. 5-15 EURcent wert – dies bedeutet somit eine Verwertungsmöglichkeit um mehrere tausend Euro.
Wie schaut es mit Förderungen aus?
Es gibt eine Vielzahl von Landes- als auch Bundesförderungen – beginnend von Zuschüssen für Energieberatung bis hin zu Förderungen für Energieeffizienzmaßnahmen bei Betrieben. Beispielhaft sei hier unter anderem das Programm des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erwähnt - „klima:aktiv energieeffiziente Betriebe“.
Im Sinne eines zielgerichteten Förderungsmanagements empfiehlt es sich, entsprechende interne/externe Vorlaufzeiten bei der Maßnahmenplanung und –finanzierung/-förderung zu berücksichtigen. Weiters gilt hier sinngemäß im Sinne eines effektiven Compliance-Management-Systems auch die diesbezüglichen Förderauflagen im Vorfeld einzuhalten, um keine „förder-schädigenden“ Handlungen im Vorfeld zu setzen bzw. hier etwaige Ansprüche zu verlieren. Auf europäischer Ebene sind auch weitere konjunkturbelebende Finanzierungspläne zur Erreichung der Energieeffizienzziele zu erwarten.
Zu Gebäuden und deren Energiebedarf Was hat der Energieausweis bewirkt – Bitte um ein kurzes Resümee?
Der Energieausweis kann als erster allgemeiner Anreiz für das Thema Energieeffizienz angesehen werden. Dies war die erste Vorschrift die dazu geführt hat, sich mit dem eigenen Gebäude und dessen Verbrauch verstärkt auseinanderzusetzen. Die Werte des Energieausweises sind mittlerweile schon wesentliche Entscheidungsfaktoren beim Verkauf und der Vermietung von Gebäuden. Das Bundes-Energieeffizienzgesetz geht nun einen Schritt weiter und zwingt im ersten Schritt die Großunternehmen, sich mit den eigenen Anlagen intensiver zu beschäftigen. Unserer Meinung nach führt dies in Zukunft zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung im Themenumfeld Energieeffizienz und gesteigerter Werthaltung der Betriebsimmobilie – dies führt wiederum zu einer höheren Effizienz, Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit.
Was bedeutet das Energieeffizienzgesetz für Immobilienbesitzer?
Das Thema Energieeffizienz erfährt eine verstärkte Berücksichtigung bei der Ressourcenplanung bzw. wird es auch entsprechend in der Kostenplanung berücksichtigt (auch als Ertrags- bzw. Kostenminderungschance). Effizienzmaßnahmen bzw. –aspekte stellen mittlerweile auch wesentliche Entscheidungsgrundlagen bei der Grundsatzentscheidung hinsichtlich Gebäudeerrichtung dar. Bestehende bzw. bereits beschlossene Investitionen werden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit neu beurteilt: es erfolgt eine Bewertung anhand von Lebenszykluskosten von Immobilien, wobei hier die Bedeutung der abgezinsten Lebenszyklusbetriebskosten in Relation zu den Gesamtkosten zu erwähnen ist.
Danke an
Udo Altphart und Christian Ehrenhauser.
 Wie schon angesprochen, ist im Moment Industrie 4.0 ein
großes Thema. Dabei geht es um die Vernetzung von Produktion, Internet und
IT-Systemen. In der smarten Fabrik kommunizieren die Maschinen miteinander. Das
bringt viele Vorteile wie sinkende Produktionskosten und höhere
Produktionsqualität. Natürlich gibt es initiale Hürden wie Investitionskosten
und unzureichende Qualifikationen der Mitarbeiter, aber im Endeffekt ist eine
Umstellung auf Industrie 4.0 auch für den Mittelstand leistbar und notwendig.
Wie schon angesprochen, ist im Moment Industrie 4.0 ein
großes Thema. Dabei geht es um die Vernetzung von Produktion, Internet und
IT-Systemen. In der smarten Fabrik kommunizieren die Maschinen miteinander. Das
bringt viele Vorteile wie sinkende Produktionskosten und höhere
Produktionsqualität. Natürlich gibt es initiale Hürden wie Investitionskosten
und unzureichende Qualifikationen der Mitarbeiter, aber im Endeffekt ist eine
Umstellung auf Industrie 4.0 auch für den Mittelstand leistbar und notwendig.