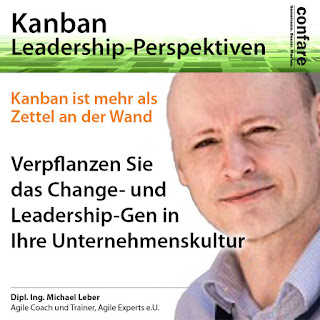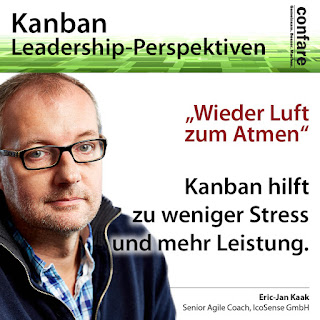CIO AWARD Preisträger Eric-Jan Kaak über das Managen der Komplexität und die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen
 Eric-Jan Kaak, Agiler Coach bei IcoSense, hat als CIO von Blizzard und der
Tecnica Gruppe große ERP Projekte geleitet und wurde mit dem Confare CIO AWARD ausgezeichnet. Im Gespräch rät er zu
Misstrauen, wenn ERP Hersteller versprechen, die Welt würde mit einem neuen
System plötzlich rosarot. Gelegenheit Eric-Jan Kaak persönlich zu erleben
bieten seine Keynote Vorträge bei 2 Confare Veranstaltungen im Oktober, dem ERP
Infotag am 6. Oktober im Wien Museum und bei #Digitalize 2016 im Wiener Chaya
Fuera.
Eric-Jan Kaak, Agiler Coach bei IcoSense, hat als CIO von Blizzard und der
Tecnica Gruppe große ERP Projekte geleitet und wurde mit dem Confare CIO AWARD ausgezeichnet. Im Gespräch rät er zu
Misstrauen, wenn ERP Hersteller versprechen, die Welt würde mit einem neuen
System plötzlich rosarot. Gelegenheit Eric-Jan Kaak persönlich zu erleben
bieten seine Keynote Vorträge bei 2 Confare Veranstaltungen im Oktober, dem ERP
Infotag am 6. Oktober im Wien Museum und bei #Digitalize 2016 im Wiener Chaya
Fuera.
Welche Rolle spielt ERP noch als Kernsystem eines Unternehmens?
Das richtige Wort ist "Kernsystem". Welche
Funktion hat ein ERP System im Kern? Es bildet datenmäßig alle Prozesse eines
Unternehmens ab.
In Wikipedia wird das beschrieben, was die Softwareindustrie
uns seit 25 Jahren versucht unter ERP zu verkaufen: "ERP-Systeme sollten
weitgehend alle Geschäftsprozesse abbilden. Eine durchgehende Integration und
eine Abkehr von Insellösungen führen zu einem ganzheitlichen ERP-System, in dem
Ressourcen unternehmensweit verwaltet werden können. ERP-Systeme verbessern
zudem den Kommunikationsfluss im Unternehmen und können im Sinne von
E-Collaboration die Zusammenarbeit im Unternehmen effizienter
gestalten."
Ein "ganzheitliches" ERP System, setzt aber auch
ganzheitliches Denken und Handeln voraus. Eigenschaften, die man in vielen
Unternehmen mit der Lupe suchen muss.
Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, in dem nach der
Einführung einer ERP Software plötzlich alle von der Verbesserung der
Kommunikationsflüsse gesprochen haben.
Wenn ERP wieder auf das reduziert wird, was es sein sollte,
gibt es durchaus noch ein Berechtigungsdasein.
Betriebswirtschaftliche Daten werden in einer Datenbank
erfasst. Die Business Logik jedes ERP-Systems ist im Grunde doch folgende:
Durchlaufzeit so gering wie möglich - Lagerstand so gering wie möglich. Das
kann ein ERP-System berechnen, besser als jeder Mensch. Dazu kommt noch ein
ordentliches Stammdatenmanagement (Master Data Management), um die Produkte und
Dienstleistungen möglichst effizient und effektiv zum Kunden zu bringen. Für
diese Funktionen hat ERP eine wichtige Funktion. Ebenso für die geregelte Welt
des Rechnungswesens mit ihren Konsolidierungen und unterschiedlichen
Bewertungsmethoden ist ERP durchaus bedeutend.
Alles, was stabil laufen sollte und wenig Veränderungen
unterliegt, ist wunderbar geeignet, um von ERP-Systemen "verwaltet"
zu werden. Für dynamische Markt- und Businessumgebungen gibt es inzwischen
genügend Lösungen in der Cloud.
Wann sollte ein Unternehmen auf die Suche nach einem neuen
ERP-System gehen?
Sind die etablierten ERP-Systeme geeignete Werkzeuge, um
Unternehmen fit für das Digitale Business zu machen?
Ein Unternehmen sollte sich ständig überlegen, ob die
bestehenden Werkzeuge den Herausforderungen des Jetzt und der Zukunft gewachsen
sind. Immer und jederzeit.
Das klingt unmöglich, aber es ist an der Zeit, die Bedeutung
von ERP anders zu denken.
ERP-Systeme waren zu einer bestimmten Zeit durchaus eine
sinnvolle Lösung, wenn es darum ging, komplizierte Prozesse zu managen.
Um die richtige Funktion eines ERP-Systems zu verstehen,
müssen wir zuerst begreifen, wie Systeme - hiermit meine ich die ganzen
Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihr Umwelt - funktionieren. Man muss
einen Unterschied machen zwischen "einfach", "kompliziert",
"komplex", "chaotisch" und "Verwirrung", wie es
der walisische Forscher und Wissensmanagement-Berater Dave Snowden macht. In
seinem Framework - er nennt es "Cynefin", was "Lebensraum"
auf walisisch bedeutet - kategorisiert er Problemsituationen und Systeme gemäß
ihrer Ordnung und deren Wechselwirkungen und leitet daraus Handlungsmuster ab.
In einfachen Systemen ist die Beziehung zwischen Ursache und
Wirkung für alle offensichtlich und es können bewährte Praktiken ("best
practices") angewandt werden. Die Reihenfolge der Handlungen, um mit
einfachen Systemen umzugehen ist "beobachten - kategorisieren -
reagieren".

Kompliziert bedeutet, dass Ursache und Wirkung eines
Ereignisses zwar zeitlich und räumlich voneinander getrennt sind, im Prinzip
ist aber der gesamte Verlauf der Aktionskette vorhersehbar: A ergibt immer B.
Man braucht Fachwissen, um die Wirkungen zu verstehen, aber mittels der
Methodiken "beobachten - analysieren - verstehen" können "good
practices" herausgearbeitet werden.
Mithilfe moderner ERP-Systeme ist man durchaus in der Lage,
einfache und komplizierte Prozesse abzuwickeln und zur Zufriedenheit des Kunden
zu Ende zu führen. Auch andere Standardisierungswerkzeuge, wie z.B. ITIL,
PRINCE2, Wasserfall, etc. funktionieren in einem komplizierten Umfeld.
Der Satz "das haben wir immer schon so gemacht"
ist in diesem Kontext durchaus treffend.
Im Gegensatz zu komplizierten Systemen ist das Verhalten
komplexer Systeme nicht vorhersagbar. Einzelteile eines komplexen Systems
können standardisiert (einfach oder kompliziert) ablaufen, aber die Interaktion
der einzelnen Teile verursacht eine ständige Veränderung. Dadurch entsteht
Komplexität.
Angetrieben durch die Technologien des 21. Jahrhunderts
(Social Media - Cloud - Big Data - Mobile) entsteht ein hochdynamisches Umfeld.
Die darin befindlichen Systeme können mit den Lösungen der "Good
Practices" nicht mehr beherrscht werden.
In diesem Fall sind Tools, Standardisierung, Regeln,
Strukturen oder Prozesse keine hinreichende Antwort, wenn es um Probleme
und Problemlösung geht. Gerade die
Methoden, die im Industriezeitalter nützlich waren, versagen: In einem
komplexem Umfeld geht es nicht um die Frage, wie ein Problem gelöst wird,
sondern wer das tun kann. Deswegen werden erfahrene Menschen bedeutsam.
Menschen mit Können und Ideen. Snowden empfiehlt hier die Vorgehensweise
"probieren - beobachten - reagieren". Es gibt in Teilen erkennbare
Muster und etliche Unbekannte. Komplexe Systemumgebungen brauchen eine
Projektmethode, die Lernen zulässt und fördert. Hier sind agile Methoden wie
Kanban oder Scrum zu Hause.
In chaotischen Systemen können keine
Ursache-Wirkungsbeziehungen identifiziert werden. Eine neue Aufgabe ist in
einem neuen Umfeld zu erledigen. Es gibt viele Unbekannte und viele
Turbulenzen. Auf identischen Input kann das System mit unterschiedlichen
Outputs reagieren, da es sich beständig verändert. Hier muss man Prototypen
entwickeln und aus den Erkenntnissen lernen. Kontinuierlich.
Ein gezieltes und gesteuertes Vorgehen ist in chaotischen
Systemen nicht möglich, deshalb ist hier der empfohlene Lösungsansatz:
"handeln – beobachten – reagieren“.
Wenn Anforderungen und Handlungen überhaupt nicht mehr
kompatibel sind, befindet sich das System in einem Zustand der
"Verwirrung" - das Management zieht sich dann in ihre Komfortzone
zurück ("das haben wir noch nie so gemacht") und es werden
Entscheidungen nur aufgrund bestehender Erfahrungen gemacht ("da könnte ja
jeder daherkommen") - ohne Rücksicht auf die aktuelle Situation.
In einem komplexen und chaotischen Umfeld versagen die
heutigen ERP-Systeme vollkommen - blöd ist es nur, dass die Anbieter den
Anspruch erheben "alles auf Knopfdruck" lösen zu können.
Das heißt, wenn es in Unternehmen Prozesse gibt, die seit
Jahren nach dem gleichen reproduzierbaren Muster ablaufen, sind ERP-Systeme
durchaus die Lösung. Wenn jedoch Themen wie Skalierbarkeit Richtung Cloud,
moderne User-Interfaces, mobile Anbindung des Außendienstes, etc auf den Tisch
kommen, dann sollte man darüber nachdenken, bestehende-ERP Systeme zu
modernisieren.
Allerdings, wenn es darum geht, in der komplexen
Wirtschaftswelt von heute zu überleben, sprich: mit Komplexität umzugehen, ist
ein neues ERP-System sicherlich nicht die Antwort. Einfach weil ERP-Systeme auf
komplexe Herausforderungen keine Antwort haben.
Niels Pfläging schreibt in seinem Buch "Organisation
für Komplexität. Wie Arbeit wieder lebendig wird – und Höchstleistung entsteht
" richtig: "Komplexität kann weder gemanagt, noch reduziert werden.
Man kann ihr nur mit menschlichem Können begegnen."
Was empfiehlst Du Unternehmen, die aktuell ein neues ERP
suchen? Welche Anforderungen sind dabei wichtig?
Man sollte sich zuerst die Frage stellen: "Auf welche
Frage ist "Ein neues ERP-System" die Antwort?" Was ist überhaupt das Problem?
Die ERP-Hersteller versprechen seit Jahrzehnten die Lösung
aller Businessprobleme, in der die Welt auf Knopfdruck plötzlich rosarot wird.
Unternehmen tappen in die Informationsfalle und glauben,
dass die Reporting-Blindheit mit der jahrzehntelangen Pflege von Daten- und
Informationssilos plötzlich von einem umfassen, allwissenden Informationssystem
abgelöst wird.
In der IT kennen wir alle die Kette: Daten - Information -
Wissen - Weisheit.
Jeder erhofft sich Weisheit aus den ERP-Daten.
Der Weg dorthin ist aber sehr beschwerlich. Mit Daten kann
ich folgende Fragen beantworten "Was ist passiert?", da sind die
ERP-Daten wesentlich, da sind aber auch die meisten stehen geblieben.
Wer aber beantwortet folgende Fragen mit den Daten aus dem
ERP-System:•Was ist passiert? (Daten)
•Was wird passieren?
•Warum ist das passiert?
•Was passiert gerade?
•Was machen wir jetzt?
•Was bedeutet das für den Kunden? (Weisheit)
Big Data und Internet der Dinge / Industrie 4.0 versprechen
uns die Antworten auf die letzte Frage; viele Unternehmen sind aber noch gar
nicht so aufgestellt, als dass sie in der Lage wären, die Frage nach der
Kundenbedeutung zu beantworten.
Wenn ich als Unternehmen aber nicht in der Lage bin, mich so
aufzustellen, dass ich die Anforderungen des 21. Jahrhunderts meistern kann,
werde ich das sicherlich mit einem ERP-System auch nicht besser bewältigen.
Die Frage also lautet: Bin ich flexibel genug in meiner
Struktur und transparent in meinen Entscheidungswegen, oder bin ich im Grunde
noch eine klassische hierarchische Organisation, in der Anforderungen und
Strategien von oben nach unten rieseln und Information über das, was am Markt
geschieht, gefiltert zurück nach oben getragen werden. Und in der man sich
monatlich über Abweichungen vom längst obsoleten Plan unterhält in
KPI-Sitzungen, die nie nach dem "Warum machen wir das?", sondern
immer nach dem "Wer ist verantwortlich?" fragen.
Softwarelösungen allein lösen nichts. Was digital entsteht,
muss analog weiterverfolgt werden und anders herum. Wissen, das in einer
Datenbank liegt, ist noch immer keine Expertise. Technische Lösungen können
Information unterstützen, sie ersetzen aber nicht Entscheidungen, die zum Wohl
des Kunden beitragen sollen.
ERP-Systeme können wunderbare Antworten liefern - sie nehmen
die Menschen aber nicht aus der Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen.
Wenn ich bereit bin, die Unternehmensstrukturen und die
Unternehmenskultur an die moderne Zeit anzupassen, kann ERP ein winziger
Baustein sein. Nicht mehr.
Welche Veränderungen erwartest Du im ERP-Markt? Welche Art
von Anbietern haben Zukunft?
Der ERP-Markt wird zu einem Kundenmarkt - künftig wird nicht
mehr der bisherige Haus-und-Hof-ERP-Lieferant das Sagen haben, sondern
überwiegend die ERP-Anwender. Sucht der Anwender neue Lösungen, sei es für
Teilbereiche oder auch für mehr, wird er sich nicht mehr wie bisher ziemlich
alternativlos an seinen üblichen ERP-Komplett-Anbieter wenden, sondern sich
aktuell am Markt orientieren und frei wählen. Damit ist die Zeit der
langjährigen Bindung zum alleinigen ERP-Lieferanten vorbei.
Kunden werden Lösungsanbieter bevorzugen, die ihnen dabei
helfen, die komplexen Probleme dieser Zeit zu meistern. So ist die
Herausforderung des Autoherstellers nicht mehr, wie er noch sparsamere
Automobile entwickeln kann, sondern wie er mit Mobilität im Zeitalter
begrenzter Ressourcen und zunehmender Urbanisierung bei gleichzeitiger
Digitalisierung umgeht. Sportartikelhersteller müssen ihre Produkte nicht mehr
nur pünktlich in die Läden liefern, sondern sich gleichzeitig darüber Gedanken
machen, welchen Stellenwert der stationäre Einzelhandel heutzutage überhaupt
noch haben kann.
Plötzlich werden die bewährten Geschäftsmodelle (mit den
darunter in Beton gegossenen Prozessen im ERP-System) angegriffen und von heute
auf morgen abgelöst.
ERP-Systeme und deren Hersteller liefern auf diese
existentiellen Fragen zur Zeit nur ungenügende Antworten.
Die Strategie muss heißen:
"Flexibilität" und "Eat Your Own Dogfood" - die
Flexibilität, die die Anbieter beim Kunden predigen, müssen sie auch vorleben.
Es werden jene überleben, die den Kunden vom derzeitigen
Blindflug in den Sichtflug begleiten.
Bei einzelnen Projekten sollte es darum gehen, die Ziele dem
anzupassen, was momentan am sinnvollsten erscheint, und dafür die passenden
Mittel auszuwählen, anstatt stur dem nachzurennen, was vor ewigen Zeiten
beschlossen wurde.
Und statt das zu tun, was man sich einst vorgenommen hat,
oder noch schlimmer, das zu tun, was man nun mal so macht, sollte es um die
richtigen Resultate gehen. Nicht das machen, was der Kunde will, sondern das,
was der Kunde braucht.
Zudem werden sich auch die Business-Modelle der Anbieter
ändern: Mietmodelle werden die Regel werden – modulare und anpassbare
Front-Ends lesen Daten aus, die der Kunde wieder verwerten kann. Die Business
Logik dazu gibt’s in der Cloud.
Hersteller, die noch immer Monolith-Systeme kaufen, werden
vom Markt verschwinden. Früher war ERP die Welt - heute ist es nur ein kleiner
Teil dieser komplexen Welt. Nicht unbedeutend - aber die Welt funktioniert auch
ohne.
Zu den Vorträgen von Eric-Jan Kaak können Sie hier Details
finden, und sich anmelden:
Confare ERP-Infotag 2015, 6. Oktober, Wien Museum, Wien
Bio: Eric-Jan Kaak arbeitet als Senior Agile Coach bei
IcoSense – ein IT-Startup Unternehmen in Zell am See. Nach langjähriger
Tätigkeit als Controllingleiter und CIO in nationalen und internationalen
Unternehmensgruppen, entwickelt und implementiert er nun gemeinsam mit Partnern
und Kunden neue Organisations- und Businessmodelle um Firmen fit für die
Herausforderungen der Digitalen Gesellschaft zu machen. Für seine Pionierarbeit
bei der Einführung von kanban im IT-Umfeld wurde er 2013 mit dem Confare CIO
Award ausgezeichnet – IBM bezeichnet
Eric-Jan als einer von weltweit 10 „Wild Ducks“ – Leute, die immer auf
der Suche sind nach Neuem, und die
Neugier, Kreativität und Technologie zum Wohle aller miteinander
verknüpfen.“
 Unternehmen stehen vor der Herausforderung ihre Produkte und
Dienstleistungen den Marktanforderungen anzupassen. Auch etablierte
Geschäftsmodelle müssen hinterfragt werden. Mithilfe neuester digitaler
Technologien können komplett neue Geschäftsbereiche gestartet werden. Mit IoT
können z.B. Herstellungs- und Logistikprozesse optimiert werden. So werden
beispielsweise Einsätze mit dem Fahrzeugpark effizienter planbar. Andererseits
können Qualitätssteigerungen durch frühzeitige Erkennung von Produktionsfehler,
erreicht werden. Nicht zuletzt können basierend auf den Daten, die durch IoT
überhaupt erst zur Verfügung stehen, neue Services geschaffen werden. So wird
z.B. der Garage vom Autohersteller gemeldet, dass er ihr Fahrzeug zur Wartung
aufbieten sollte.
Unternehmen stehen vor der Herausforderung ihre Produkte und
Dienstleistungen den Marktanforderungen anzupassen. Auch etablierte
Geschäftsmodelle müssen hinterfragt werden. Mithilfe neuester digitaler
Technologien können komplett neue Geschäftsbereiche gestartet werden. Mit IoT
können z.B. Herstellungs- und Logistikprozesse optimiert werden. So werden
beispielsweise Einsätze mit dem Fahrzeugpark effizienter planbar. Andererseits
können Qualitätssteigerungen durch frühzeitige Erkennung von Produktionsfehler,
erreicht werden. Nicht zuletzt können basierend auf den Daten, die durch IoT
überhaupt erst zur Verfügung stehen, neue Services geschaffen werden. So wird
z.B. der Garage vom Autohersteller gemeldet, dass er ihr Fahrzeug zur Wartung
aufbieten sollte.